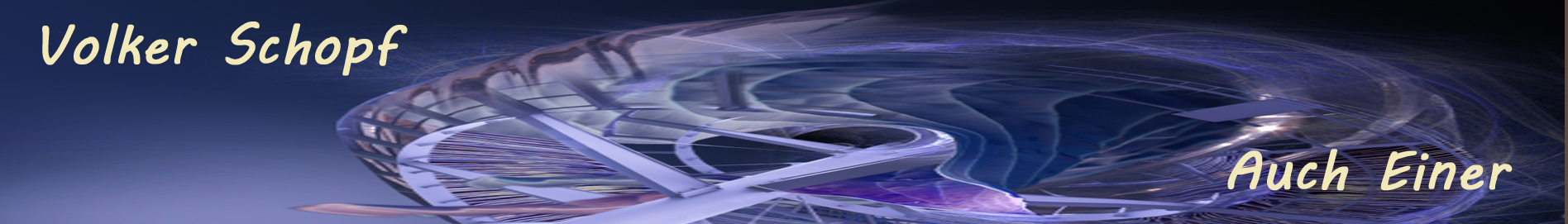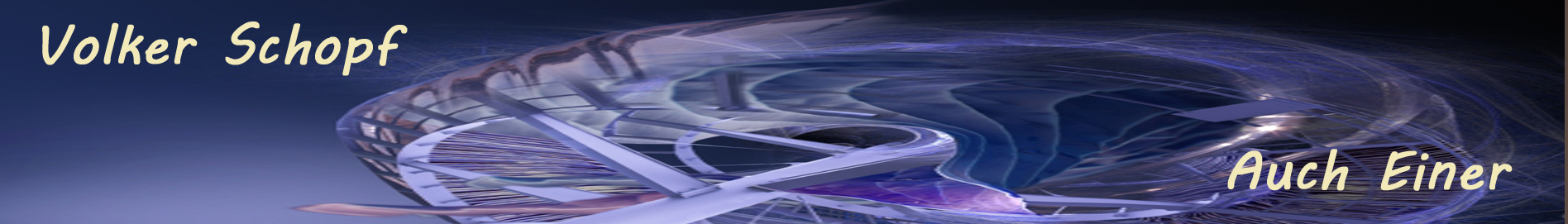Transzendenz
Anhand des Begriffs ʼTranszendenz‘ lässt sich die Debatte um die Verstehbarkeit der Realität in ihrem gesamten Spektrum aufzeigen. Betrachten wir hierzu die beiden westlichen Hauptströmungen: Rationalismus und Empirismus. Ersterer wird z. B. von Platon, G. W. Leibnitz und R. Descartes vertreten und geht von der Behauptung aus, dass das ʼIch bin‘ allein durch das Denken Erkenntnisse über die Realität erlangen kann und im Gegensatz dazu antwortet der Empirismus, der von J. Locke, G. Berkeley und D. Hume ausgearbeitet wurde, dass Erkenntnis für das ʼIch bin‘ nur aus der Erfahrung gewonnen werden kann. I. Kant vereinte die beiden Richtungen, indem er behauptete:
ʼDaß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist kein Zweifel. […] Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.’1
Die sogenannte kopernikanische Wende lenkte das Augenmerk des ʼIch bin‘ darauf, wie unser kognitives Bewusstsein arbeitet, und es schuf ein philosophisches System, das die gesamte westliche Philosophie beeinflusste, den ʼTranszendentalen Idealismus.‘
Daraus folgt: Der Mensch muss Erfahrungen machen, um überhaupt Wissen zu erlangen. Jedoch ist sein Bewusstsein in der Lage, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, welche mit keiner Erfahrung verknüpft sein müssen. Diese Erkenntnisweise wird als a priori (vom Früheren her) bezeichnet, während a posteriori (von dem, was nachher kommt) die aus der Erfahrung gewonnene Erkenntnis beschreibt. Somit unterschied Kant zwischen der ʼWelt der Erscheinungen‘ und dem ʼDing an sich‘ als getrennte Realitäten, wobei er davon ausging, dass von dem ʼDing an sich‘ keine Erfahrung möglich ist, weil es die Fähigkeiten des ʼIch bin‘ überschreitet. Es erfährt von dem ʼDing an sich‘ Wirkungen und wird deshalb in Bezug auf die Erkenntnis auf den individuellen Schauplatz des Denkens beschränkt.
Spätere Philosophen wie G. W. Hegel und F. Nietzsche distanzierten sich von I. Kant und dessen Rationalismus. Nietzsche z. B., indem er das ʼDing an sich‘ völlig leugnete, es als nicht existent annahm. Nicht mehr die Suche nach der Wahrheit war von Bedeutung, sondern die ʼWelt der Erfahrungen‘ und deren Befriedigungen für das ʼIch bin‘. Außerdem soll das ʼIch bin‘ sich von sämtlichen moralischen Konzeptionen befreien, dann – so folgerte Nietzsche – bleiben nur die reine Form und Struktur.
Die Erkennbarkeit der Realität bzw. die Suche nach der ihr zugrunde liegenden Wahrheit wird heute ebenso kontrovers diskutiert wie zu ihrem Beginn. Hören wir abschließend K. Jaspers:
ʼDas Umgreifende der Welt ist das, was in seinem dunklen Sein durch nichts deutlicher werden kann. Es ist der Ursprung aller Realität dessen, was wir Materie nennen. […] Sobald wir es erkennen, fassen wir es gegenständlich in ihm zugehörende Kategorien, in Raum und Zeit, Kausalität und Dinghaftigkeit usw.
‘[…] Das umgreifende Weltsein spricht zu uns durch die Sprache der Erkennbarkeit der Erscheinungen, Transzendenz durch die Sprache der Chiffren’2 ʼ[…] Das Umgreifende der Welt ist nur im Transzendieren zu berühren, nicht im Wissen zu fassen. Dennoch ist für ihn ʼDie Welt‘ grundsätzlich begreiflich.‘3
K. Jaspers spricht hier stellvertretend für die Vertreter der Existenzialisten, die Induktion nur in der materiellen Realität für wissenschaftlich gerechtfertigt erachten, sie in der transzendenten Erfahrung deshalb verwerfen, weil die Verallgemeinerung von Erfahrungen der Realität auf die sie bedingenden Gesetzmäßigkeiten für sie nicht gangbar ist.
Meiner Meinung nach ist der Kosmos für das ʼIch bin‘ mit jedem Jetzt umfassender begreifbar, trotz der Unmöglichkeit, ihn als Einheit wahrzunehmen. Gerade die Vielfältigkeit der bewussten Wahrnehmung, die ihm als Erkenntnis aufscheint, zwingt uns zu dem Schluss, dass stets dieselben Gesetzmäßigkeiten in Erscheinung treten und die Evolution des Kosmos prägen.
1 Kant: AA III, Kritik der reinen Vernunft, 2000, Bd. 1, S. 45
2 Karl Jaspers, Von der Wahrheit, August 2001, S.88 f
3 Ebd. S. 93.